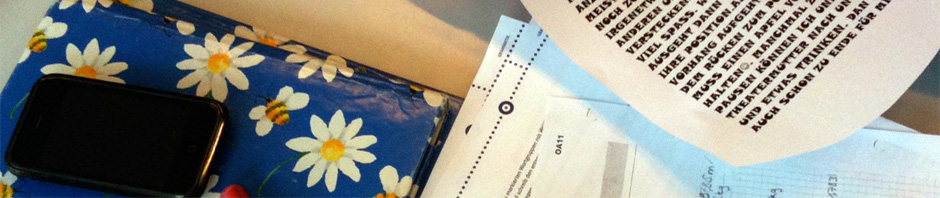Von persönlichen Erfahrungen mit dem neuen Beurteilungsreglement im Kanton Schwyz – ein Einblick aus dem Klassenzimmer
Seit der Einführung des neuen Beurteilungsreglements im Kanton Schwyz sind wir Lehrpersonen aufgefordert, die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler basierend auf den Richtlinien des Lehrplans 21 zu überprüfen. Dabei wird ausdrücklich erwartet, vielfältige Methoden der Leistungsüberprüfung einzusetzen.
Ich plane hier keinen Leitfaden zu entwickeln, vielmehr möchte ich persönliche Erfahrungen aus dem Fachbereich „Natur, Mensch und Gesellschaft“ teilen.
Zu Beginn des Jahres beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit dem menschlichen Körper. Wie funktionieren unsere Muskeln? Welche Voraussetzungen braucht unser Körper, um stehen, gehen oder sogar springen zu können? Und letztlich: Warum bewegt sich der Mensch aufrecht, eine Fähigkeit, die vielen Tieren fehlt oder nur kurzzeitig gelingt?
Damit die Schülerinnen und Schüler ihr Verständnis zeigen, gestalteten sie ein digitales Lernprodukt. Dabei hatten sie Freiheit bei der Wahl der Form, ob sie ihre Erklärungen per Video oder Audio aufnehmen wollten. Die Mehrheit entschied sich für die Videofunktion, vermutlich, weil sie damit körperliche Abläufe wie das Zusammenspiel von Bizeps und Trizeps besser veranschaulichen konnten.
Im Februar stand der Blutkreislauf im Zentrum. Dieses Mal lautete die Aufgabe, den Kreislauf schriftlich zu erklären. Mich interessierte sehr, wie die Schülerinnen und Schüler diesen Wechsel empfanden. Neun von 21 Kindern hätten die Aufgabe lieber mündlich abgegeben. Ihre Begründungen lauteten etwa: „Ich kann mehr sagen, wenn ich es aufnehme“ oder „Dann muss ich nicht so viel schreiben.“ Auch Aussagen wie „Beim Sprechen fühle ich mich wohler“ kamen häufig vor.
Diejenigen, die die schriftliche Form bevorzugten, nannten hingegen andere Vorteile: „Ich kann meinen Text überarbeiten und ergänzen, wenn mir noch etwas einfällt.“ und „Das Aufnehmen finde ich stressig.“ Die Gründe zeigten deutlich, wie unterschiedlich die Lernenden ihre Stärken und Herausforderungen einschätzen.
Im März folgte mit dem Wasserkreislauf ein dritter Themenschwerpunkt. Hier konnten die Schülerinnen und Schüler frei entscheiden, ob sie ihre Kenntnisse per Video, Audio oder schriftlich darlegen wollten. Sechs von 21 wählten die schriftliche Form. Auffallend war, dass alle sechs ausführliche Texte ablieferten (eine A4 Seite und mehr). Das Schreiben fällt ihnen erfahrungsgemäss leicht. Ich erhebe hier nicht den Anspruch, dass es repräsentativ ist, aber interessant war auch der geschlechtsspezifische Unterschied. Etwa 40 Prozent der Mädchen wählten die schriftliche Variante, bei den Knaben waren es nur rund 10 Prozent.
Die Beurteilung der Produkte hat sich für mich als Lehrperson nicht verändert. Bei jeder Kompetenz und den dazugehörenden Lernzielen setzte ich fest, was man zeigen/ erklären/ nennen/ darstellen sollte, um zu zeigen, dass die Kompetenz verstanden und erreicht wurde. Ob ich dies in einem Video mit Unterstützung von zeigen auf Körperteile, mit Audio sprachlich detailliert erklärt oder schriftlich erklärt mit möglichen Zeichnungen ist nebensächlich. Es warf auch keine Fragen bei Schülerinnen und Schülern oder deren Eltern auf.
Diese Erfahrungen zeigen, wie wertvoll und sinnvoll es ist, den Schülerinnen und Schülern verschiedene Möglichkeiten anzubieten. Oft kennen sie ihre Stärken und nutzen sie, wenn man ihnen die Freiheit dazu gibt. Anstatt Stärken zu zeigen, geht es manchmal auch darum Schwächen zu verringern. Deswegen mache ich mir bei jeder Prüfung und Produktabgabe Gedanken, ob organisatorisch eine Wahl möglich ist, um möglichst auf Stärken zu bauen und Schwächen zu verringern.