Heutzutage ist es offensichtlich, dass sind digitale Geräte allgegenwärtig sind. Schon die Kleinsten können nicht mehr ohne Smartwatches oder Tablets. Oft hört man die Frage: „Warum verbieten wir es nicht einfach in der Schule?“ Doch ist ein Verbot wirklich die Lösung? An der Projektschule Goldau stellen wir uns dieser Frage immer wieder und nahmen deshalb beim Projekt „Flimmerpause“ teil.
Das Experiment: Eine Woche ohne digitale Geräte
Im Lehrplan steht: „Der Schüler/die Schülerin kann sein/ihr Medienverhalten reflektieren.“ Um dies umzusetzen, haben wir in der 5. Klasse eine Woche lang auf alle elektronischen Geräte verzichtet – sowohl zu Hause als auch in der Schule. Jeden Morgen füllten die Schüler und Schülerinnen ein Protokoll des Vortages aus und wir reflektierten vor, während und nach dem Projekt. Hier sind einige besondere Beobachtungen:
- Mathematik in Papierform: Bei den Kindern beliebt waren die Mathelösungen in Papierform an der Tafel. Im Alltag werden diese elektronisch im Programm Learningview freigeschaltet. Laut Aussagen der Kinder sei es einfacher zu korrigieren und sie schätzten die zusätzliche Bewegung welche dabei entstand.
- Erfolg und Herausforderungen: Von 21 Kindern schafften es nur sieben, die Woche ohne elektronische Geräte zu überstehen. Die meisten konnten ihren Konsum reduzieren, aber einige waren fest entschlossen, nie wieder eine Flimmerpause zu machen.
- „Sinnvoller Gebrauch“: Ein Kind war mitten in den Proben für ein Musicalprojekt. Seine Übungsstücke wurden per MP3 zur Verfügung gestellt. In der Reflexion besprachen wir, dass das Üben der Stücke kein Regelbruch sei. Um nicht auf andere Handyfunktionen abzuschweifen, könnte auch die Mama die Stücke abspielen.
Das Klassenlager: Ein weiterer Schritt
Da das Projekt ein Teilerfolg war, passte es hervorragend, dass wir fürs Klassenlager in der 6. Klasse alle elektronischen Geräte zu Hause zu liessen. Es stellte sich heraus, dass die Kinder besonders schätzten, immer jemanden zum Spielen zu haben und neue Spiele kennenzulernen. Obwohl wir bereits bei der Flimmerpause besprachen, wie man ohne Geräte abmachen kann, schien dies doch ein größeres Hindernis zu bleiben. In der Diskussionsrunde am Montag nach dem Lager vermissten tatsächlich nur wenige ihre digitalen Geräte. Einige übergaben ihr Gerät den Geschwistern, um allfällige Nachrichten zu beantworten oder den Snapchat-„Flämmli“-Streak aufrechtzuerhalten. Den Kontakt mit anderen zu verlieren, falls sie kontaktiert würden und niemand antwortete, war die größte genannte Besorgnis.
Ein Kind verlor den 90-Tage-Übungsstreak auf Duolingo. Dabei stellte sich für mich die Frage: Wenn das Kind schon lernen will, sollte man das nicht erlauben? Allerdings ist Duolingo stark gamifiziert und aus pädagogischer Sicht mit Lob nach jeder einzelnen Aufgabe doch etwas fragwürdig. Gerade deshalb ist es mir wichtig, mit den Kinder zu thematisieren, dass solche Apps das Ziel haben, die Benutzer bewusst locken möglichst viel Zeit darauf zu verbringen. Damit werden mehr Abos und Zusätze verkauft. Zur Unterhaltung mit den Kindern gehört, dass eigentlich nichts passiert, wenn man den Streak verliert. Schlussendlich hast du gelernt und was du dir angeeignet hat, kann dir niemand nehmen.
Fazit
Solche Experimente sind wertvoll. Reine Diskussionen, „ohne Gewohnheiten zu ändern „am eigenen Leib“ zu erfahren, sind für die Schülerinnen und Schüler schwer fassbar. Ebenfalls ist es wichtig, sie zu begleiten, damit sie nicht über AHA-Erlebnisse hinwegsehen. Die „Flimmerpause“ hat gezeigt, dass es möglich ist, ohne digitale Geräte auszukommen und dass es Vor- und Nachteile hat. Es ist ein Schritt, um ein bewussteres Medienverhalten zu fördern.
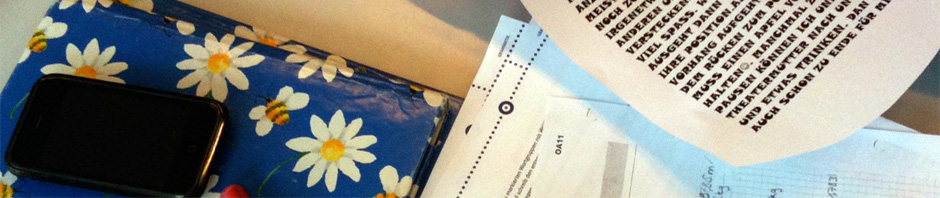
Vielen Dank für den Bericht, ich fand ihn sehr interessant. Ich bin eher Team Verbieten, mir da aber nicht sicher, und sehe das so oder so nicht kommen.